Der dritte Mann. Wie über Ostern sprechen?
Zwei Männer verlassen am Tag nach dem Sabbat die Stadt Jerusalem. Ihr Ziel ist der Ort Emmaus, ihr Heimatort. Unterwegs begegnen sie einem Menschen, der ihnen die Bibel erklärt. Zunächst haben sie keine Ahnung, wer ihr Begleiter ist. Doch am frühen Abend fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen.
Die Geschichte der Männer von Emmaus findet sich im letzten Kapitel des Lukasevangeliums (Lk 24,13-35). Es ist eine Ostergeschichte. Dieser Blogbeitrag schlägt vor, so von Ostern zu sprechen, wie Lukas von der Begegnung mit dem Auferstandenen erzählt.
Dreierlei verbindet die Emmaus-Erzählung mit anderen österlichen Geschichten der Evangelien: Sie beginnt wie jene mit traurigen Menschen und endet mit einer Überraschung, die ihr Leben für immer verändert.
Doch vor dieser Wendung zum Glück steht ein retardierendes Element. Diejenigen, denen eine visionäre Begegnung mit dem Auferstandenen zuteilwird, erkennen ihn zunächst nicht. So erzählt der Evangelist Johannes, dass Maria Magdalena denkt, der Gärtner stünde vor ihr. Erst als der Auferstandene sie anspricht, merkt sie, dass sie Zeugin des Osterwunders geworden ist.
Und ein Drittes: Die visionären Begegnungen dauern nur einen kurzen Moment, doch die Freude bleibt. Er lebt! Anders als vorher, aber er lebt!
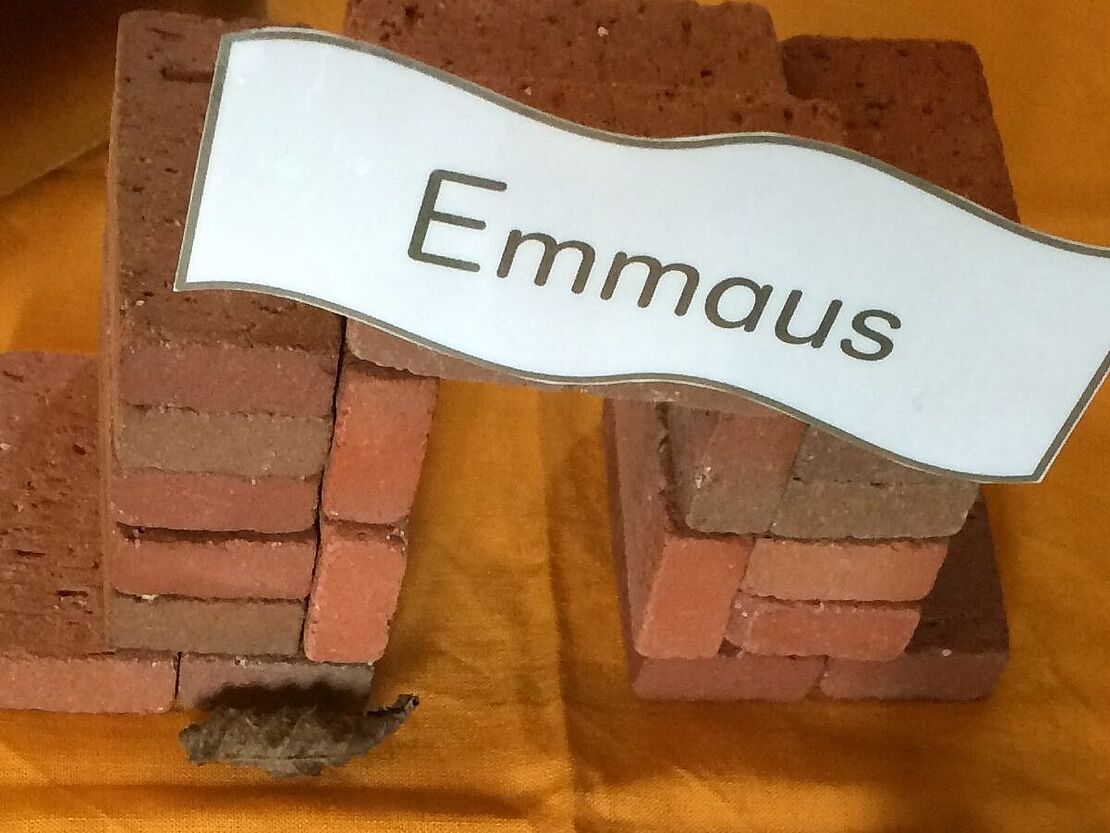
Wie könnte ein Unterricht zur Emmauserzählung angelegt sein?
Exposition
Zunächst erzählt die Lehrperson, dass sich zwei Männer – der eine heißt Kleopas, der Name des anderen ist leider nicht überliefert – zu Fuß auf die Heimreise machen. Sie sind traurig, dass Jesus, auf den sie als Retter gehofft hatten, hingerichtet worden ist. Da gesellt sich ein Fremder zu ihnen, sie haben ihn gar nicht kommen sehen. Für den Rest der Strecke wandern zu dritt.
Frage und Gegenfrage
Der Fremde will wissen, warum die beiden Männer traurig sind. Sie antworten mit einer Gegenfrage:
„Bist du der einzige Mensch, der nicht weiß, was in diesen Tagen in Jerusalem geschehen ist?“
„Was denn?“, fragte der Mann (nach Lk 24,18).
Die Reaktivierung der Passion
Nun sind die Lernenden am Zug. Was ist denn „in diesen Tagen in Jerusalem“ geschehen? Sie erinnern sich an Episoden der Passionsgeschichte Jesu. Sie beginnen beim Einzug in Jerusalem, erzählen vom letzten Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern, seiner Gefangennahme durch die Tempelwache und enden mit dem Ereignis der Kreuzigung. (Vielleicht muss die Lehrperson ein bisschen helfen.)
Weder eine ausführliche Nacherzählung der Leidensgeschichte noch eine theologische Vertiefung sind an dieser Stelle erforderlich. Auch die biblische Emmaus-Erzählung enthält kaum Dogmatik. Warum Jesus sterben musste, wird mit Verweis auf das Alte Testament beantwortet. „Es kam so, wie es geschrieben steht. Es musste so sein.“ (nach Lk 24,26)
Eine gewisse Detailgenauigkeit bei der Reaktivierung des Gelernten ist allein da geboten, wo vom Letzten Abendmahl die Rede ist. Da darf der folgende Satz nicht fehlen:
Jesus nahm das Brot, brach es und gab es ihnen (nach Lk 22,19).
Der Fortgang der Erzählung
Die theologische Unterweisung durch den Unbekannten mag bewirkt haben, dass die Zeit beim Wandern schnell verging. Die Traurigkeit wird sie nicht vertrieben haben. Als sie in Emmaus ankommen, tut der Begleiter so, als wolle er weitergehen. Die Gastfreundschaft aber gebietet etwas anderes. Die beiden Wanderer nötigen ihn, mit ihnen zusammen zu Abend zu essen. Als sie gemeinsam zu Tisch sitzen, wissen sie noch immer nicht, wer ihr Begleiter ist. Das retardierende Moment hält an.
Die Überraschung
Die Geschichte nimmt nun eine Wendung. Denn nicht der Gastgeber teilt das Brot und gibt es seinen Gästen. Der Gast wird selbst aktiv.
Da nahm der Fremde das Brot und brach es und gab es ihnen (nach Lk 24,30).
In diesem Moment geht den beiden ein Licht auf. Sie erinnern sich. Ihr Begleiter tut, was Jesus am Tag vor seinem Tod getan hatte. Er hatte das Brot geteilt, ein Gebet und ein Segenswort gesprochen, und danach war der Kelch herumgegangen. „Denkt an dieses Abendmahl, wenn ihr wieder zusammen esst und trinkt“, hatte er gesagt
Früher als gedacht tun sie das. Und tatsächlich, sie müssen dabei an Jesus denken. Offenbar war er es, der ihnen die Bibel erklärt hatte.
Sie können ihr Glück kaum fassen. An seinem Äußeren, an seinem Gang, seiner Kleidung oder seiner Stimme haben sie ihn nicht erkannt. Die Symbolhandlung des Brotbrechens aber öffnet ihnen die Augen. In dem Moment, in dem sie das verstanden haben, ist er aber schon wieder verschwunden.
Die Entdeckung, die die Jünger von Emmaus machen, machen in diesem Moment auch die Schülerinnen und Schüler. Haben sie zuvor gehört, wie Jesus mit den Jüngern das Brot gebrochen hat, verstehen sie jetzt (und fragen zugleich): Das muss Jesus sein! Wie ist das möglich? Er lebt. Anders als vorher, aber er lebt. Oder?
In der Tat: Anders als vorher. Denn physisch bleibt er nicht lange bei den Menschen. Der Auferstandene nicht „zu fassen“, nicht „zu begreifen“. Die Begegnungen enden unvermittelt, sobald die Traurigkeit in Freude verwandelt ist.
Die Vergewisserung
Das Erlebnis von Emmaus will geteilt werden. Die beiden Männer machen sich umgehend auf den Rückweg nach Jerusalem. Sie haben etwas erlebt, das will erzählt werden. Als sie in Jerusalem eintreffen, wundern sie sich wohl kaum noch, dass der Auferstandene den Jüngerinnen und Jüngern dort zur gleichen Zeit auch erschienen ist.
Wie reden wir angemessen über das Ostergeschehen?
Der Evangelist Lukas weist uns den Weg. Systematische theologische Sätze versuchen das Überraschende und Unfassbare in unvollkommene Worte zu fassen. Fast immer sind sie zudem schwer zu verstehen. Fundamentalistische Vereinfachungen überzeugen nicht, symboldidaktische Wege werden überschätzt. Religionspädagogisch tun wir uns keinen Gefallen, wenn wir im Unterricht von der Auferstehung als einem Substantiv sprechen. Die Auferweckung Jesu ist kein historisches Ereignis wie die Kreuzigung, sondern eine Begegnungserfahrung. Nicht umsonst wählen die Evangelisten das Format einer Erzählung. Für Unterricht und Predigt ist das sicher ein angemessener Weg, über Ostern zu sprechen.
Horst Heller, „Rühre mich nicht an!“ Maria Magdalena und ihr Ostererlebnis, das sie nicht anfassen, sondern nur nacherzählen kann
horstheller.wordpress.com/2023/04/08/ruhre-mich-nicht-an-maria-magdalena-und-ihr-ostererlebnis-das-sie-nicht-anfassen-sondern-nur-nacherzahlen-kann/
Horst Heller, War das Grab Jesu am Ostermorgen leer? Und ist das überhaupt wichtig?
horstheller.wordpress.com/2024/03/30/war-das-grab-jesu-am-ostermorgen-leer/
